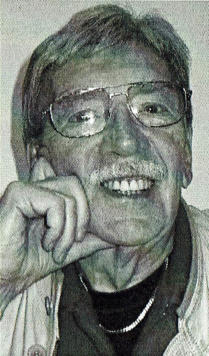bei Halle an der Saale
Willkommen in Dölau
Dölauer*innen
vorgestellt

Hilmar Thate
geboren am 17.April 1931 in Dölau
gestorben am 14.September 2016
Er besuchte hier und später in Halle die Schule. In der Folgezeit entwickelte sich
der Wunsch in ihm einmal auf der Bühne zu stehen.
Und dieser Traum wurde wahr.
Auf der Umschlagseite seines Buches “Neulich, als ich noch Kind war”
wird er wie folgt beschrieben:
“Hilmar Thate, geboren 1931 in Dölau bei Halle an der Saale, verkörpert über fünf
Jahrzehnte deutscher Theater- und Filmgeschichte.
1958 trat er dem Berliner Ensemble bei. Eine große Karriere begann mit wichtigen
Rollen an den bedeutensden deutschsprachigen Bühnen. 1980 musste er
zusammen mit seiner Frau Angelica Domröse die DDR verlassen. Hilmar Thate ist
Mitgied der Akademie der Künste und erhielt zweimal den Nationalpreis der DDR,
den Adolf-Grimme-Preis und den Bayrischen
Fernsehpreis. Seine “Welt” war und ist Berlin, wo er lebt.”
Zur Erinnerung seien einige seiner Filme genannt:
1955
Einmal ist keinmal
1958
Jahrgang 21,
1958
Das Lied der Matrosen
1960
Leute mit Flügeln
1961
Mutter Courage und ihre Kinder
1961
Professor Mamlock
1961
Der Fall Gleiwitz
1964
Der geteilte Himmel
1973
Zement
1974
Die Wahlverwandtschaften
1976
Daniel Druskat
1978
Fleur Lafontaine
1980
Don Juan, Karl-Liebknecht-Straße 78
1981
Engel aus Eisen
1982
Die Sehnsucht der Veronika Voss
1983
Dingo
1990
Hurenglück
1997
Der König von St. Pauli
1999
Wege in die Nacht
2000
Krieger und Liebhaber
2002
Zweikampf
2004
Der neunte Tag
2005
Hitlerkantate
Karl Werner 25.04.1892 - 24.12.1963
Karl Werner, der bis zu seinem Tod in Dölau im
Heideweg 15 wohnte, war nicht nur ein einfacher
privater Malermeister. Er gehörte zu den
Handwerkern, die sich auch um die Ausbildung des
fachlichen Nachwuchses kümmerten. Im
Heideschlösschen gab er in einem Raum des
Erdgeschosses, der von der Malerinnung gemietet
war, Unterrichtsstunden für die zukünftigen
Handwerker seiner Zunft.
Was ihm nun aber einen Platz in der Dölauer Geschichte einräumt, ist
sein Beitrag für die Heimatgeschichte des Ortes.
In seiner Freizeit zog er mit Malerstaffelei oder Zeichenblock durch den
Ort bzw. die unmittelbare Umgebung und zeichnete interessante
Objekte oder einfach die Natur.
Damit wurden Blicke festgehalten, wie wir sie heute zumTeil nicht mehr
entdecken können. Der Hauptteil seines Nachlasses befindet sich,
bis auf wenige im Privatbesitz befindliche Bilder, im Stadtarchiv der
Stadt Halle (Saale).
In diesem Zusammenhang sei dem Stadtarchiv für die Bereitstellung
zwei seiner Bilder gedankt, die hier bewundert werden können.
Persönliche Daten:
geboren am 25.04.1892 in Hamburg
Lehre als Maler von 1907-1910
Gesellenprüfung 31.01.1910
Meisterprüfung am 22.03.1919
Geschäftseröffnung 01.04.1920
gestorben am 24.12.1963 in Dölau
Bilder zum Vergrößern anklicken!
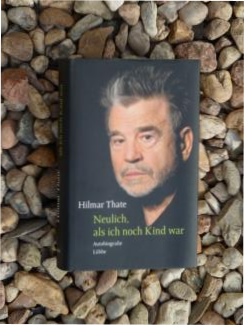
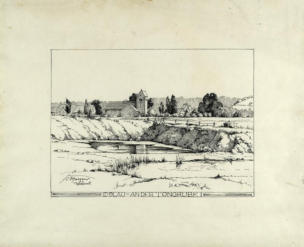

Erik Neutsch 21. Juni 1931 - 20. August 2013
Besonders die Generationen, die in der DDR aufwuchsen, kennen seinen Namen.
Aber auch nach der Wende, als die Beiträge über die in der DDR verbotenen Filme
aufkamen, rückte sein verfilmter Roman „Spur der Steine“ mit Manfred Krug in die
Schlagzeilen der Medien. Erik Neutsch hat sich vor Jahren in Dölau niedergelassen
und arbeitete intensiv an den letzten zwei Bänden seines Zyklus „Friede im Osten“,
der einmal 6 Bände umfassen sollte.
Frau Dr. Evelin Wittich beschreibt anlässlich des 80. Geburtstages von Erik Neutsch
in einer Veröffentlichung
1)
das Leben des Schriftstellers wie folgt:
Erik Neutsch wurde am 21. Juni 1931 in Schönebeck an der Elbe als Kind in einer sozialdemokratisch geprägten Arbeiterfamilie
geboren. Die Erzählungen seines Vaters zum Beispiel über die Verbrüderung mit den Russen 1917 an der Ostfront oder darüber
wie es war, wenn gestreikt wurde und er (der Vater) als Angehöriger der Streikführung dem Großvater als Streikbrecher
gegenüber stand, hinterließen tiefe Spuren bei dem Jungen. Dennoch ließ er sich durch die Nazis verführen und träumte von
einem Nibelungenreich in einem Großdeutschland. Der 1943 verstorbene Vater konnte es nicht verhindern. Mit 14 ½ Jahren kam
er unter Werwolfverdacht für ein Dreivierteljahr in ein Gefängnis des NKWD aus dem er mit eigenen Worten als ein anderer
Mensch herauskam. Neutsch trat 1947 in die FDJ und 1949 in die SED ein, studierte von 1950 bis 1953 Gesellschafts-
wissenschaften, Philosophie und Publizistik an der Universität Leipzig, wo er als Diplom-Journalist abschloss. Anschließend
arbeitete er als Kultur- und Wirtschaftsredakteur bei der Bezirkszeitung „Freiheit“ in Halle von 1953 bis 1960. Seine
Leidenschaft war und ist das Schreiben – auch über den täglichen Journalismus hinaus. So erschienen Anfang der 60er Jahre
seine ersten Erzählungen und 1964 der Roman «Spur der Steine», der mehr als 500.000 mal verkauft wurde.
Neutsch war dem Theater sehr verbunden, schrieb 1971 das Schauspiel «Haut oder Hemd», das am Landestheater Halle Premiere
hatte, und im gleichen Jahr das Libretto für die Oper «Karin Lenz». Im Jahr 1974 beginnt er mit dem Romanwerk «Der Friede
im Osten», das vor dem historischen Hintergrund der Jahre 1945 bis 1990 den Werdegang seiner Generation gestaltet, die
untrennbar mit der Entwicklung der DDR verbunden war. Vier Bücher sind erschienen und an dem fünften arbeitet er zur Zeit.
Die Planung und Realisierung seiner Werke nahm mitunter Jahrzehnte in Anspruch und Neutsch begab sich oft in die
Lebensumstände seiner Romanhelden. So arbeitete er zum Beispiel auf dem Bau, ging in die Nationale Volksarmee und war im
Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld tätig.
Er betrachtet die Autoren Büchner und Forster, die sich für die Interessen der Plebejer einsetzten, als seine literarischen
Vorfahren und eines seiner großen Vorbilder ist Scholochow. Ihn faszinierten seine Professoren, zu denen Ernst Bloch, Fritz
Behrens, Ernst Engelberg, Wieland Herzfelde und andere gehörten.
Über seinen Anspruch an seine Literatur schreibt Erik Neutsch: „Meine Figuren müssen konkret sein, realitätsbezogen und dazu
gehört nun mal ihr gesamtes soziales Umfeld, das durch kaum ein anderes so geprägt wird, wie durch die Arbeit. Nur so, durch
sein Tätigwerden bis ins Detail, wird ein Zimmermann zum Zimmermann, eine Architektin zur Architektin oder gar … ein Hirt
zum Hirten. An seiner Arbeit lässt sich letztlich auch der Charakter eines Menschen messen. Und wie man sehen kann, habe ich
in all meinen Büchern zumindest die Hauptperson immer wieder in ihrer Produktivität gezeigt … Wollte ich darauf verzichten,
auf die Soziologie der schönen Details, wäre es, als beschriebe ich einen Menschen nur zur Hälfte, nicht einmal das, nur als
seinen Schatten. Für meine dem Realismus verhaftete Auffassung begänne da eine Literatur des lebens- und weltfremden
Nichtssagens, entweder des Elitären oder des Klischees.“
Werke von Erik Neutsch
Die Regengeschichte, Halle (Saale) 1960
(Erzählung)
Bitterfelder Geschichten, Halle (Saale) 1961
(Erzählband)
Die zweite Begegnung, Halle (Saale) 1961
(Erzählung)
Spur der Steine, Halle (Saale) 1964
(Roman)
Die anderen und ich, Halle (S) 1970
(Erzählband)
Olaf und der gelbe Vogel, Berlin 1972
(Kinderbuch)
Haut oder Hemd, Halle 1972
(Schauspiel)
Auf der Suche nach Gatt, Halle (Saale) 1973
(Roman)
Karin Lenz, Berlin 1972
Libretto zur Oper von G. Kochau
Tage unseres Lebens, Leipzig 1973
(Erzählband)
Der Friede im Osten, Halle (Saale)
1. Buch Am Fluß, 1974
Romanzyklus
2. Buch Frühling mit Gewalt, 1978
Romanzyklus
3. Buch Wenn Feuer verlöschen, 1985
Romanzyklus
4. Buch Nahe der Grenze, 1987
Romanzyklus
Heldenberichte, Berlin 1976
(Gesammelte Erzählung)
Akte Nora S. und Drei Tage unseres Lebens, Berlin 1978
(2 Erzählungen)
Der Hirt, Halle (Saale) 1978
(Erzählung)
Fast die Wahrheit, Berlin 1979
(Essays)
Zwei leere Stühle, Halle [u. a.] 1979
(Novelle)
Forster in Paris, Halle [u. a.] 1981
(Historische Erzählung)
Da sah ich den Menschen, Berlin 1983
(Lyrik und Dramatik)
Claus und Claudia, Halle [u. a.] 1989
(Erzählung)
Totschlag, Querfurt 1994
(Roman)
Vom Gänslein, das nicht fliegen lernen wollte, Leipzig 1995
(Kinderbuch)
"Der Hirt" und "Stockheim kommt", Berlin 1998
(2 Erzählungen)
Die Liebe und der Tod, Halle an der Saale 1999
(Gedichte)
Nach dem großen Aufstand, Leipzig 2003
(Roman über Grünewald)
Verdämmerung, Kückenshagen 2003
(Essayistische Erzählung)
1)
Auszüge der Veröffentlichung von Frau Dr.Evelin Wittich zum 80. Geburtstag von Erik Neutsch auf den Seiten der R-L-Stiftung; Berlin, den
21.6.2011
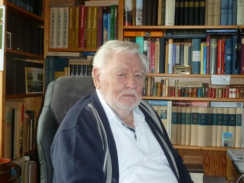
***
***
***
***
Prof. Dr. Hans-Ulrich Demuth
geboren am 27.Februar 1953
Am 29.09.2008 meldeten die Medien in Zeitungen, Rundfunk und
Fernsehen: „Wissenschaftlern aus Mitteldeutschland ist ein Durchbruch bei
der Alzheimerforschung gelungen! Mit ihrem Forschungsansatz könnte
Alzheimer in ein paar Jahren heilbar sein. … Das Mitteldeutsche
Gemeinschaftsprojekt von Alzheimerforschern aus Halle, Magdeburg und
Leipzig hat ein vollkommen neues Terapiekonzept entwickelt. … Sie
fanden heraus, dass ein bisher unbekanntes Eiweiß für die Bildung von
Ablagerungen im Gehirn verantwortlich ist, was dessen absterben massiv
beschleunigt. … So entwickelte man weltweit einen neuen Wirkstoff, der
das gefährliche Eiweiß hemmt und zum Rückgang der
Alzheimersymptome führt.“
1)
Prof. Dr. Demuth wurde in Halle (Saale) geboren. Er besuchte die Friedensschule im halleschen Stadtteil
Ammendorf zwischen 1959 und 1967 und legte das Abitur 1971 an dem jetzigen Giebichensteingymnasium
„Thomas-Müntzer“ in Halle ab. Nach dem Wehrdienst von 1971 bis 1973 begann er sein Studium an der Martin-
Luther-Universität in Halle (Saale). Sein Diplom als Biochemiker legte er an der damaligen Sektion
Biowissenschaften der Universität 1977 ab und promovierte 1982 zum Dr. rer. nat.
Im Fach Biochemie habilitierte Hans-Ulrich Demuth 1990. Als er sich 1991 einer Jury des Bundesforschungs-
ministeriums mit seinem damaligem Projekt „Niedermolekulare Inhibitoren Prolin-spezifischer Enzyme als potentielle
Pharmaka“ stellte, konnte er mit seinen Mitarbeitern als eine von zehn Nachwuchsgruppen in den neuen
Bundesländern seine Arbeit fortsetzen. Ab 1993 beschäftigte sich diese Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr.
Hans-Ulrich Demuth dementsprechend intensiv mit der Diabetes-Wirkstoffforschung.
Die neue Strukturpolitik an der Universität nach der Wende veränderte zunächst den akademischen Lebenslauf des
Wissenschaftlers in Halle. So konnte er dank der Förderung durch das Bundesforschungsministeriums und der
Zusammenarbeit mit dem Hans-Knöll-Institut in Jena seine Forschungen an einem möglichen Diabetes-Medikament
als Leiter der Abteilung Wirkstoffbiochemie des heutigen Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und
Infektionsbiologie fortsetzen.
Um seine Arbeiten zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen, gründetet er schließlich zusammen mit Dr. Konrad Glund
1997 die Firma „Probiodrug“.
Zunächst im Technologie- und Gründerzentrum der halleschen Weinberge, und heute im Biozentrum des Weinberg-
Campus fand die Forschergruppe ihre neue Wirkungsstätte.
Hans-Ulrich Demuth ist seit 2001 Forschungsvorstand der von ihm gegründeten Probiodrug AG und seit 2006
Professor für Pharmabiotechnologie an der Hochschule Anhalt in Köthen.
Die größten Erfolge sind neue Therapiekonzepte bei der Behandlung von Diabetes und die bereits angesprochenen
Ergebnisse zur Behandlung von Alzheimer. In Halle leitete er bis Ende 2019 eine Außenstelle des Fraunhofer-
Instituts für Zelltherapie und Immunologie.
Wir danken Prof. Dr. Demuth für die bereitgestellten Informationen.
1)
Kommentar der Sendung „sachsen-anhalt-heute“ des MDR vom 29.09.2008
Dieter Schmeil
geboren am 27.Januar 1936
Wer sich für die Geschichte von Dölau interessiert, kommt an
seinen Ausarbeitungen nicht vorbei. Dieter Schmeil ist es zu
verdanken, dass wir heute mehr über unseren Ort wissen, als vor
einigen Jahrzehnten. Er ist ein echter Ur-Dölauer: Hier
geboren, hier zur Schule gegangen, über Jahre gemeinnützig in
Dölau engagiert und bis heute Einwohner des Ortes. Dieter
Schmeil fühlt sich fest mit Dölau verbunden. So ist es nicht
verwunderlich, dass er in Dölau „Hinz und Kunz“ kennt. Durch
die vielen Gespräche mit Zeitzeugen von Dölau ist wohl so
mancher Funke für die Dölauer Historie gezündet worden.
Als er 1996 in den Vorruhestand gehen konnte, hat er begonnen diese Überlieferungen zu Papier zu bringen. Es
wurde aus dem Schweißfachmann ein Ortschronist. Die nun als Rentner zusätzlich zur
Verfügung stehende Zeit, gab ihm die Möglichkeit die Geschichte Dölaus intensiver
festzuhalten und zu dokumentieren. So wurden zum Beispiel die bis dahin gesammelten und
erworbenen Postkarten, Urkunden, Zeitungs- und Gesprächsnotizen digitalisiert und die von
Dölauer Einwohnern zur Verfügung gestellten Bilder abfotografiert. Er recherchierte in den
Archiven, führte Gespräche und brachte auch die eigenen Erinnerungen zu Papier bzw. auf
die Festplatte des Computers. Wer sein Arbeitszimmer betritt, kann an den vielen
Aktenordnern und Ablagen ermessen wie viel Zeit hier investiert wurde und wird. Auf diese
Weise ist schon eine beachtliche Seitenzahl der Dölauer Geschichte zu Papier gebracht,
gedruckt und gebunden worden. Immerhin zählt die Chronik von Dölau bis heute (2012) 243
Seiten. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Immer wieder werden neue Fakten bekannt, die
ihn den Inhalt der Chronik Dölaus erweitern oder vervollständigen lassen. Im
„Geschichtskreis Dölau“, deren Mitglied er ist, werden neue Erkenntnisse
zusammengetragen und zugearbeitet. Abschließend würde Dieter Schmeil sicherlich sagen:
„Man kann vieles machen, aber man ist auch auf die Mitarbeit seiner Mitmenschen angewiesen. Manch altes Foto,
ein altes Schriftstück oder eine Überlieferung aus einer alten Kiste kann für den Chronisten wie ein Lottogewinn
sein!“
***
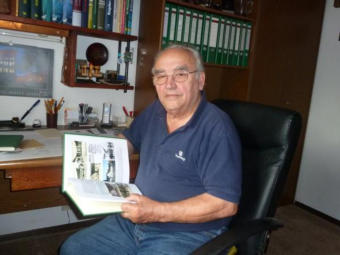

***
Hans Joachim Schramm
11.Dezember 1930 - 11.Juni 2023
Wenn
Sie
sich
für
Sagen,
Erzählungen,
interessante
Begebenheiten
aus
der
Region
oder
die
Geschichte
von
Dölau
interessieren,
so
ist
Ihnen
Hans
Joachim Schramm garantiert ein Begriff.
Der
1930
in
Halle
(Saale)
Geborene
hat
in
seinem
Leben
viele
Geschichten
und
Märchen
geschrieben
und
Zeichnungen
sowie
Aquarelle
geschaffen.
Selbst
so
manches
handgeschnitzte
Kunstwerk
trägt
die
Initialen des Allroundkünstlers aus der Stadtforststraße in Dölau.
Auf
Grund
seiner
künstlerischen
Fähigkeiten,
die
seine
Mutter
frühzeitig
erkannte,
konnte
er
im
Herbst
1945
eine
Lehre
als
Goldschmied
an
der
Kunstschule Burg Giebichenstein in Halle
(heute
Burg
Giebichenstein
Kunsthochschule
Halle)
beginnen.
Nach
dem
Abschluss
dieser
Ausbildung
bot
sich
für
ihn
die
Möglichkeit
die
künstlerische
Ausbildung
fortzusetzen
und
auf
anderen
Gebieten
Erfahrungen
zu
sammeln.
Er
lernte
in
der
Malerklasse
von
Professor
Haas.
In
der
Klasse
der
Bildhauerei
studierte
er
Metallbildhauerei,
sowie
Grafik
bei
Professor
Post
und
erlernte
das
Kunstgiesen
bei
Herrn
Näher.
Nach
dem
10.Semester konnte er schließlich seine erste Stelle als Goldschmied beginnen.
Da
es
in
den
50er
Jahren
noch
schwer
war
seine
Existenz
mit
einem
solchen
Handwerk
abzusichern,
musste
er
sich
beruflich
neu
orientieren.
Deshalb
nahm
er
die
Stelle
als
Werbeleiter
bei
der
HO
im
Saalekreis
an.
Als
sich
nach
Jahren
die
Möglichkeit
bot
wieder
als
Goldschmied zu arbeiteten, nutze er diese Chance, um seine Leidenschaft zum künstlerischen Handwerk zu befriedigen.
Neue
Inspirationen
bekam
er
durch
seine
Frau
Karin,
die
er
im
Erzgebirge
kennen
lernte.
Sie
machte
ihn
mit
dem
Werkstoff
Holz
vertraut
und
inspirierte
Hans
Joachim
Schramm
seine
handwerklichen
Fähigkeiten
hier
anzuwenden.
Dies
war
eine
Bereicherung
für
die
von
seiner
Frau im Jahr 1974 in Dölau gegründeten Werkstatt für Kunstgewerbe.
Aus
schmucklosen
Baumstämmen
schnitzte
er
Eulen,
Hirsche,
Wildschweine,
Steinböcke
u.a.
Skulpturen.
Für
Tierfreunde
fertigte
er
zur
Erinnerung
lebensgroße
Nachbildungen
von
den
verstorbenen
Lieblingen
auf
Basis
von
Fotos
an.
Als
kleine
„Serienproduktion“
wurden
zu
DDR-Zeiten Nussknacker und Lichterengel gefertigt. Später wurde der Nussknacker durch eine kleine Pyramide ersetzt.
Nach
der
Wende
fanden
Urlauber
aus
den
USA,
Japan
und
Frankreich
Gefallen
an
den
Holzarbeiten.
Die
verkauften
Einzelexemplare
wurden
Botschafter
der
Holzschnittkunst
aus
Dölau.
Auf
diese
Weise
kamen
Nachfragen
aus
diesen
Ländern
und
trugen
so
die
Zeugnisse
der Schrammschen Kunst über tausende Kilometer in ferne Länder.
Seine
Liebe
gilt
jedoch
nicht
nur
der
Schnitzkunst.
Seine
zweite
Berufung
sind
das
Schreiben
und
Zeichnen.
Die
Freude
zum
Zeichnen,
die
seit
den
Kinderjahren
in
ihm
steckt,
ist
bei
allen
Orientierungsversuchen
nicht
verloren
gegangen.
Schon
nach
seiner
Ausbildung
hat
Hans
Joachim Schramm zahllose Illustrationen für Bücher und Journale angefertigt.
Neben
den
vielen
Zeichnungen,
die
wir
in
den
„Dölauer
Heften“
finden,
gab
er
zahlreichen
Büchern ein schöneres und interessanteres Aussehen.
Mit
einem
aufmerksamen
Ohr
für
das
Leben
der
Menschen
hat
er
Geschichten
und
Sagen
des
Volkes
zu
Papier
gebracht
und
auch
eigene
Geschichten
geschrieben.
Diese
Sagen
und
Erzählungen
wurden
mit
seinen
Zeichnungen
illustriert.
Ein
Beispiel
dafür
ist
sein
Buch
„Sagen der Dölauer Heide“.
Im
Laufe
der
Jahre
ging
sein
Blick
weit
über
die
Halleschen
Grenzen
hinaus.
Geschichten
über
die
Uckermark,
das
Erzgebirge
gehörten
ebenso
zu
seinen
Werken,
wie
Bücher
über
die
„Randfichten“
oder
die
Moderatorin
im
MDR-Fernsehen
Marianne
Martin
mit
der
Sendung
„So klingt’s bei uns im Arzgebirg“.
Werke von Hans Joachim Schramm:
Sagen der Dölauer Heide, Verlag Freiheit Halle 1970
Sagen aus dem Saalkreis, Verlag Freiheit Halle 1970
Von der Dölauer Heide bis Rothenburg/S - Geschichten und Sagen, Verlag Bodo Schwarzberg Halle 1982
Geheimnisse der Uckermark, Eigenverlag 1983
100 Jahre Bäderbahn, Chronik der 900 mm Schmalspurbahn Bad Doberan-Kühlungsborn, Verlag Kulturbund der DDR 1986
Hallesches Magazin 1993-94, Verlag c/o Votum GGR
Von der Saalkreisgemeinde Teicha zum Petersberg. Sagen - Bräuche - Geschichten, Verlag Bodo Schwarzberg, Halle 2002
Die Wichtel der Dölauer Heide, Kinderbuch, Druckerei Schulz Teicha 2003
Sagenhaftes aus Landsberg (Heft 1 und 2), Verlag Bodo Schwarzberg Halle 2004
Zauberhafte Dölauer Heide - Sagen und Erzählungen. Projekte-Verlag Halle 2005
Hoppel und Moppel die Hasenkinder (Heft 1 und 2, Kinderbuch), Projekte-Verlag Halle, 2005
Ja, er lebt noch ...: Der Holzmichl und andere Geschichten aus dem Erzgebirge, Projekte-Verlag 188, 2005
Der Wiesenkooz und andere Geschichten, Projekte-Verlag Cornelius Halle, 2006
Anthologie Jahrbuch für das neue Gedicht, August v. Goethe Literaturverlag, Frankfurt/M 2006
Besinnliches zur Weihnachtszeit, August v. Goethe Literaturverlag, Frankfurt/M 2006
Stadt Landsberg. Erzählungen und Geschichten aus dieser Saalekreisregion, Verlag Bodo Schwarzberg. Halle 2007
Die Geschichte der Eselsmühle Halle-Neustadt und zwei Fabeln, Druckerei Schulz Teicha, 2008
Mit Mariane Martin durchs Zwönitztal, Geschichten aus dem Erzgebirge, Projekte-Verlag Halle 2009
Der Schneckenchecker: und andere Erzählungen aus Halle-Neustadt, Projekte-Verlag Halle 2009
Wir danken Herrn Schramm für die bereitgestellten Informationen. (Fotos: B.Wolfermann)
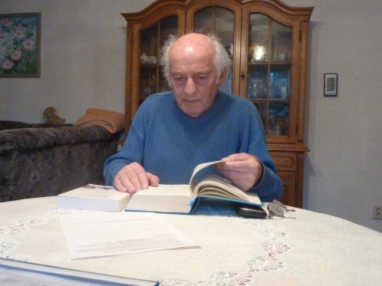

***
Gerhard Neumann
21. Februar 1930 – 24. August 2002
Als der „Verein für Friedhofskultur in Halle und dem Umland e.V.“ am 20.10.2013 eine
Führung auf dem Dölauer Friedhof mit Dr. Walter Müller durchführte, verweilte die Gruppe
der Geschichtsinteressierten an einem Grab mit der Aufschrift: Gerhard Neumann.
Zur Überraschung vieler Anwesenden erfuhr man, dass dies die letzte Ruhestätte eines
bekannten Schriftstellers ist.
Wer war Gerhard Neumann? Das Glück führte uns mit seiner Frau Margrit Lenk
zusammen, die uns Einblick in sein Leben gab:
Er war kein Ur-Dölauer. Viele Wohnungswechsel lagen – berufsbedingt – hinter ihm, als
er 1977 mit Familie nach Halle kam. Ab 1988 – schon im Rentenalter - bis zu seinem Tod
lebte er in Dölau. Doch diese Jahre waren für ihn besonders fruchtbare.
Die Wohnbedingungen, das Umfeld – für seine Tätigkeit boten sich hier die besten
Voraussetzungen. In Köthen geboren, wurde Gerhard
Neumann nach dem Abitur Schauspieler. Später kam ein Diplom als Theaterwissenschaftler
hinzu. Schon mit 22 Jahren setze man ihn - nach einer Schauspieler- und Dramaturgentätigkeit
in Bernburg - als Intendant in Staßfurt ein. Doch bald startete er mit seinem Freund und
Kollegen Hans-Albert Pederzani eine Karriere im Krimi-Genre. DIE PREMIERE FÄLLT AUS hieß
der erste Bühnen-, Roman- und Filmerfolg des Duos, das sich A.G. Petermann nannte und den
frühen DDR-Krimi entscheidend mit geprägt hat. Es gab wohl keine Bühne dieses Landes, auf
der DIE PREMIERE nicht AUSFIEL.
Vom Theater wechselte Gerhard Neumann zum Film, wurde Dramaturg bei der DEFA und
schrieb eine Reihe Filmdrehbücher – darunter natürlich auch solche für Kriminalfilme.
Er blieb, dann ohne seinen Partner, dem Krimi-Genre treu bzw. kehrte – nach neuerlichen
Ausflügen ans Theater (als Intendant in Halberstadt, Quedlinburg, Eisleben) und recht
erfolgreichen Versuchen mit dem „großen Roman“ (ICH KANNTE CARABAS) – wieder dorthin
zurück. Kriminalromane, die hohe Auflagen erreichten, entstanden. In seiner Dölauer Zeit
humorige Kriminalerzählungen, kamen etliche, vielfach sehr manche mit deutlichem Halle-
Lebewelt der „Goldenen Zwanziger“ Bezug, und beachtliche historische Krimis, die in der
Berliner spielen, hinzu. Zudem trat er theoretischen Arbeiten zum Genre mit Kritiken zu neu
erschienen Krimis im Rundfunk und mit hervor.
ABGESANG hieß sein letzter Kriminalroman. Und mit dem unterhaltsam-besinnlichen Büchlein VORKOMMNISSE - NOTATE
AUS SIEBZIG JAHREN nahm er Abschied von seinen Lesern.
In einem Nachruf seines Schriftstellerkollegen Jan Eik heißt es: „Gerhard Neumann, Träger des Georg-Friedrich-Händel-
Preises, war ein besonders sprachbegabter und engagierter Schriftsteller, der dank seiner Kollegialität und seiner brillanten
Formulierungskunst in der Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur schnell Anerkennung fand. Im April 2002 ehrte
dieses SYNDIKAT in München Neumanns Lebenswerk mit dem Friedrich-Glauser-Ehrenpreis der Autoren. Mit seinem Tod hat
der deutschsprachige Krimi eine seiner interessantesten Stimmen eingebüßt.“
Werke
1952
J.B. Moliere, Georges Dandin, Übersetzung und Nachdichtung, Berlin
1952
Die Premiere fällt aus, Kriminalstück (als A.G. Petermann), Berlin
1953
Was 13 geschah, Schauspiel, Uraufführung Staßfurt
1955
Die Premiere fällt aus, Hörspiel (als A.G. Petermann), Berliner Rundfunk
1956
Treffpunkt Aimée, Kriminalfilm, DEFA
1956
Die Premiere fällt aus, Kriminalroman (als A.G. Petermann), Berlin
1957
Die Hunde bellen nicht mehr, Hörspiel (als A.G. Petermann), Berliner Rundfunk
1957
Spur in die Nacht, Kriminalfilm, DEFA
1957
Poloniaexpress, Spielfilm, DEFA
1958
Die Hunde bellen nicht mehr, Kriminalroman (als A.G. Petermann), Berlin
1959
Die Premiere fällt aus, Kriminalfilm (als A.G. Petermann), DEFA
1959
Meineid auf Ehrenwort, Kriminalroman (Pseudonym A.G. Petermann), Berlin
1959
Wasser bis zum Hals, Hörspiel (als A.G. Petermann), Berliner Rundfunk
1960
Einer von uns, Spielfilm, DEFA
1960
Museumsraub in Kairo, Kriminalerzählung (Pseudonym Heiner Heindorf), Berlin
1962
Hochverrat, Schauspiel, Uraufführung Halberstadt
1962
Export, Kriminalroman, Berlin
1964
Heinrich Laube Die Karlsschüler, Schauspiel, Bearbeitung und Nachdichtung, Uraufführung Quedlinburg
1970
Hallo Prometheus, Schauspiel, Uraufführung Eisleben
1973
Jenö Gilbes, Paradies der Schwiegersöhne, Operette, Bearbeitung und Nachdichtung, Uraufführung Eisleben
1974
Ein Regenbogen zog voran, Ballettlibretto, Uraufführung Eisleben
1974
Jacques Offenbach, Hoffmanns Erzählungen, Bearbeitung und Neufassung der Dialoge, Uraufführung
Rudolstadt
1975
Spiele zum Straßentheater, Uraufführung Eisleben
1977
Adolphe Adam, Der Toréador, Neuübersetzung und Nachdichtung des Opernlibrettos, Uraufführung Eisleben
1978
Die Reussische Gemme, Kriminalroman, Halle/Leipzig
1979
Adolphe Adam, Der Toréador, Neuübersetzung und Nachdichtung des Opernlibrettos, Fernsehaufführung
Deutscher Fernsehfunk (DFF)
1980
Waterloo, Kriminalroman, Halle/Leipzig
1983
Ich kannte Carabas, Roman, Halle/Leipzig
1986
Koppenreuter kommt nicht, Roman, Halle/Leipzig
1988
Die Vermummten, 33 Stenogramme um einen Mord, Kriminalroman, Halle/Leipzig
1990
Abgesang, Kriminalroman, Halle/Leipzig
1991
Feuerspuren, Kriminalroman, Berlin
1992
Kälte im Nacken, Kriminalerzählung, im Sammelband Der Mörder zieht die Turnschuh an, Dortmund
1993
Hundertjahrestheater, Erzählung im Sammelband Grenzenloses Land, Hildesheim
1993
Die Hassmord-GmbH, Kriminalerzählung, im Sammelband Der Mörder bricht den Wanderstab, Dortmund
1993
Mitwelt-Kränze für die Mimen, literarische Reportage im Sammelband Halle – Kleiner Führer durch Kunst und
Kultur, Literaturbüro Sachsen-Anhalt Süd
1993
Sechs Funkessays zur Kriminalliteratur, Deutschlandsender Kultur
1994
Nachtstück, Kriminalerzählung im Sammelband Neue ostdeutsche Krimis, Berlin
1994
Bortzinger Garten, Kriminalerzählung im internationalen Sammelband Weltkrimis-Krimiwelten, Berlin
1995
Die siebente Rippe, Kriminalerzählung im Sammelband Deutschland einig Mörderland, Berlin
1995
Ritter, Tod und Teufel, sieben gesammelte Kriminalerzählungen, Halle
1996
Polnisches Gold, Kriminalroman, Berlin
1996
Ein hallisch-himmlisches Gaukelspiel, Erzählung im Sammelband Stunde der Phantasten, Literaturbüro
Sachsen-Anhalt Süd
1997
Mord total
, Kriminalroman, Berlin
1998
Klartext
oder
Ernst
Schwetschke
stiehlt
ein
Skalpell
,
Kriminalerzählung
im
Sachsen-Anhalt-Sammelband
Das
Kind im Schrank
, Leipzig
1998
Vademecum
, ein Bericht im Sammelband
Wer dem Rattenfänger folgt
, Literaturbüro Sachsen-Anhalt Süd
1999
Tabula Rasa
, ein Kapitel im Neun-Autoren-Krimi
Die allerletzte Fahrt des Admirals
, Berlin
2001
Abgesang, presto ...
, Kriminalroman, Halle
2002
Vorkommnisse
, Notate aus siebzig Jahren
, Halle
(Der Nachlass von Gerhard Neumann befindet sich im Stadtarchiv Halle/S)
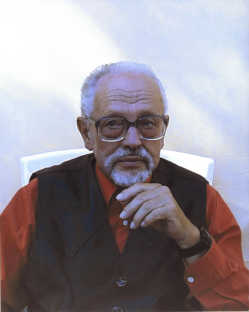

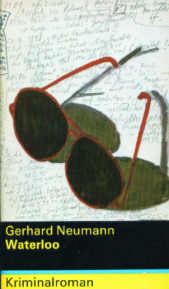
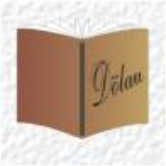

Dr. Karl Jühling
17. November 1872 – 27. Dezember 1953
Wenn ein Gast nach der „Villa Jühling“ fragt, kann fast jeder Dölauer Einwohner den Weg zu diesem
Haus beschreiben. Der Besucher meint oft nicht unbedingt das Gebäude, sondern das „Evangelische
Bildungs- und Projektzentrum“ in der Semmelweisstraße 6, dessen Träger der gleichnamige Verein
ist.
Warum tragen Haus und Trägerverein diesen Namen?
In unserem Fall ist das Ehepaar Dr. Karl Jühling und Gertrud Jühling geb. Stössner der Namensgeber
für dieses Gebäude und den Verein.
Leider gibt es relativ wenige Informationen über das Leben dieser Beiden, die einen Großteil ihres
Lebens hier verbrachten. Einige Hinweise über Karl Jühling findet man in dem Buch von Hans-Jürgen
Krisch „Firma Hensel & Haenert - Eine mitteldeutsche Kaffeegeschichte zwischen Hamburg und
München“. Diese halleschen Großhandelsfirma hatte ihren Sitz südlich der Ulrichkirche in Halle/S.
Oft wird sie, da auch hier Kaffee geröstet wurde, mit der ehemaligen Kaffeefabrik an der Thüringer
Straße verwechselt.
In dem Familienunternehmen Hensel & Haenert war Karl Jühling viele Jahre in führender Position
tätig. Die folgenden Informationen über Karl Jühling wurden zum großen Teil dem angeführten Buch entnommen.
1)
Karl Jühling wurde am 17. November 1872 in Meiningen als zweites Kind des Kaufmannes Hugo Jühling und dessen Frau Marie
Sidonie geb. Zschenderlein geboren. Sein Vater war Mitinhaber der Kaffeerösterei Roth & Sohn in Meiningen. Nach der
Schulausbildung schlug Karl Jühling die kaufmännische Laufbahn ein. Im Jahr 1891 bekam er eine Stelle als kaufmännischer
Angestellter in der bereits erwähnten Firma Karl Haenert in Halle (Saale). Durch seine umfangreichen kaufmännischen Kenntnisse
und strategisches Geschick wurde er von der Eigentümerfamilie bald als Prokurist eingesetzt.
In einem Schreiben Karl Haenerts an Geschäftsfreunde und leitende Angestellte der Firma gibt es eine Einschätzung zu dem jungen
Karl Jühling. So heißt es: „dass es sich bei ihm um leidenschaftliche Kaffeerösterei handelt, die jede Neuerung verfolgt, an der
Verbesserung der Qualität arbeitet und die Konkurrenz scharf beobachtet.“
Ständig steigende Gewinne um die Jahrhundertwende bis 1910 zeigen wie erfolgreich die Firma geführt wurde.
Das Familienunternehmen Hensel & Haenert endete 1911 mit der Überführung in eine Aktiengesellschaft. Gründer dieser
Aktiengesellschaft war Karl Jühling.
Mit dem Erwerb von 410 Aktien der Aktiengesellschaft a 1000 Mark durch Karl Jühling und weiteren 40 Aktien durch seinen Vater
Hugo Jühling wurde er in die Lage versetzt Vorsitzender des Vorstandes der Gesellschaft zu werden.
Von Vorteil für seine erfolgreiche Geschäftsführung waren mit Sicherheit Kontakte zu verschiedenen Orienten (Sitzen) von
Freimaurerlogen. Hier trafen sich Intellektuelle, führende Kräfte der Wirtschaft, des Militärs und der Verwaltung. Über diese
persönlichen Kontakte entstanden viele Geschäftsabschlüsse.
In der Bruderkette „Zu den drei Degen“ konnte Karl Jühling am weitesten in der Hierarchie aufsteigen. Er wurde am 06. Februar 1914
als Mitglied des ersten Grades in die Loge aufgenommen. In den Jahren 1931 bis 1932, kurz vor der Auflösung der deutschen Logen
durch die Nationalsozialisten, gehörte Jühling dem Ehrenrat, der Prüfungs- und Weinkommission an und übte das Amt des
Kellermeisters aus. Karl Jühling war zugleich auch Ehrenmitglied der Großen Nationalen Mutterloge „Zu den Drei Weltkugeln“.
Probleme in der von ihm geführten Firma traten mit dem Ersten Weltkrieg auf. Der Handel mit anderen Ländern kam zum Erliegen.
Einfache Lebensmittel und Ersatzstoffe nahmen nun den Platz der importierten Waren ein.
Während des Krieges setzte die Stadt Halle Karl Jühling als kaufmännischen Leiter des Stadternährungsamtes ein. Er betreute die
Verteilung der auf dem Firmengelände gelagerten zwangsbewirtschafteten Lebensmittel.
Unter seiner Leitung überstand die Firma auch die Währungsinflation Anfang der 20er Jahre und
später die Weltwirtschaftskrise. Karl Jühling hat vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten
als Mitglied der Handelskammer in der Wahlgruppe Großhandel gearbeitet. Zusätzlich begleitete
er über Jahre das Amt eines Handelsrichters.
Persönlich entstand Mitte der 20er Jahre der Wunsch den Wohnsitz aus der Stadt (Kleine
Brauhausstraße 24/25) zu verlegen. Das persönliche Vermögen ermöglichte ihm ein Grundstück
in Dölau am Rande der Heide zu erwerben. Hier ließ er 1928/29 sein Wohnhaus
3)
, die heutige
„Villa Jühling“ errichten.
In den Jahren des Nationalsozialismus, der Zeit von Importverboten an Kolonialwaren, gelang es
unter seiner Leitung den Warenhandel geschickt umzugestalten und die Firma vor Verlusten zu
schützen.
Als Leiter der Geschäftsführung hat sich Karl Jühling stets für die Belange der Angestellten und Arbeiter eingesetzt und diese über
Tarif bezahlt.
In den Jahren des Zweiten Weltkrieges schuf Karl Jühling die „Jühling-Stiftung“, die sich die Aufgabe stellte, die soziale Lage der
Mitarbeiter und ihrer Familien zu verbessern. Diese Sorge um das Wohlergehen der Beschäftigten zeugt vom
verantwortungsbewussten Handeln des Geschäftsführers. In den harten Jahren des Zweiten Weltkrieges zeugen Nachweise von
freiwilligen Sonderzuwendungen an die Mitarbeiter in Höhe von 10 bis 20 % der Lohnkosten von der sozialen Einstellung des nun
schon 70-jährigen.
Als der Krieg 1945 beendet war, führte Karl Jühling die Aktiengesellschaft unter den veränderten Bedingungen im Osten
Deutschlands weiter. Wegen verordneter Betriebseinschränkungen zog man den Schluss die Firma in der bisherigen Form nicht mehr
so weiterzuführen. Neben einer Verkleinerung der Firma wurden in der Aufsichtsratssitzung am 19. November 1950 umfangreiche
personelle Veränderungen vorgenommen. So schied Karl Jühling im Alter von 78 Jahren am 31.12.1950 aus der Firma und zog sich
in das Privatleben zurück.
1952 überschrieb er das Grundstück samt seiner Gebäude der Kirchengemeinde Lieskau.
3)
Vereinbart wurde dabei, dass das Ehepaar Jühling lebenslanges Wohnrecht behalten sollte.
Karl Jühling starb ein Jahr später am 27.12.1953 mit 81 Jahren. Seine Frau lebte bis zu ihrem Tod am
27.01.1971 im Obergeschoß des Hauses in der Semmelweisstraße 6.
Den Grabstein des Ehepaares Jühling findet man heute neben der Villa Jühling.
Quellen:
1)
Hans-Jürgen Krisch, Firma Hensel & Haenert-Eine mitteldeutsche
Kaffeegeschichte zwischen Hamburg und München 1820-1980,
Verlag H.-J. Krisch, Halle/S. 2005
2)
Foto von Karl Jühling aus dem Archiv des Vereins: „Evangelische Bildungs- und
Projektzentrum Villa Jühling e.V.“
3)
Internetseite des Vereins: „Evangelische Bildungs- und Projektzentrum Villa
Jühling e.V.“
4)
Fotos der „Villa Jühling“ und des Grabsteins des Ehepaares Jühling sind aus
dem Archiv von Bernd Wolfermann
***



***
Klaus-Jürgen Hofer
21.11.1941 - 14.01.1987
Peter Ibe, der erste hauptamtliche Naturschutzwart der DDR, bezeichnete Klaus-Jürgen Hofer als den
„Grzimek der DDR“
1)
. Den Namen des in Marienwerder (heute Kwidzyn, Polen) geborenen Tierfilmers
findet man immer wieder, wenn man in Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Natur- und Tierfotografie
blättert. Selbst in rückblickenden Bewertungen über den DDR-Tierfilm heißt es: „Fernsehserien wie
Tierparkteletreff, Der gefilmte Brehm, Rendezvous mit Tieren, Waidmannsheil oder Einzelsendungen z.B.
von Klaus Meinhardt und Klaus Jürgen Hofer waren bei den Zuschauern beliebt.“
2)
Klaus Jürgen Hofer kam mit den vielen
Flüchtlingen am Ende des zweiten Weltkrieges
aus seiner westpreußischen Geburtsstadt nach
Dölau. Die Mutter des vierjährigen Jungen war
schon früh verstorben, so dass er mit seinem
Vater und dessen Bruder in unserem Ort eine neue Heimat fand. Der
weitere Werdegang des Jungen unterschied sich sicherlich nicht von dem
anderer Kinder. Ehemalige Mitschüler der Dölauer Schule erinnern sich,
dass er ein besonderes Interesse an Pflanzen und Tieren hatte. In der
heimischen Wohnung wurde von den Erwachsenen sehr viel Wert auf
Grün, Pflanzenzucht und deren Pflege gelegt. Ein Anziehungsobjekt für
den jungen Klaus-Jürgen waren die hiesigen Aquarien. Mit Ausdauer
beobachtete er das Verhalten der Fische in dieser gläsernen Welt. Von
seinem Onkel angeregt, der ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf war, zog
es ihn mit einem Fotoapparat in die Dölauer Heide um Tiere zu
fotografieren. Da die Heide von der Wohnung, in der jetzigen Wilhelm-Biel-
Straße, in Blickweite lag, war es nur ein Katzensprung dorthin. Dieses
Hobby faszinierte ihn offensichtlich schon als Junge und er zog es allen
anderen Freizeitbeschäftigungen vor. Ob in den Schuljahren von 1948 bis
1956 bereits der Wunsch entstand einmal Tierfotograf zu werden, wäre
reine Spekulation. Zumindest hat er sich nach der 8.Klasse (An der
Dölauer Schule wurde zu dieser Zeit nur bis zur 8.Klasse unterrichtet.) für
den Abschluss der Mittelschule in Halle entschieden. Nach der 10.Klasse
begann er eine Lehre als Fernsehmechaniker und arbeitete bei der „PGH
(Produktionsgenossenschaft des Handwerks) Radio und Fernsehen“ in
Halle. Während der Lehre wandte sich Klaus-Jürgen Hofer einem neuen
Hobby zu. Einer seiner sportbegeisterten Nachbarn gewann ihn für den
Skisport. Er wurde Mitglied der BSG Einheit Mitte Halle, Abteilung
Wintersport. Eine sicherlich ungewöhnliche Sportart für unsere Breiten.
Aber beim ASK (Armeesportklub) Oberhof organisierte der hallesche
Sportverein Skiroller. Diese wurden für die jungen Sportler das
Trainingsgerät in den Zeiten ohne Schnee. Mancher Bewohner der
heutigen Otto-Kanning-Straße erinnert sich noch, wie Klaus-Jürgen Hofer
mit einer Bleiweste umschnürt, schwitzend, die in dieser Zeit noch wenig
befahrene Straße auf und ab fuhr. Die Haupttrainingsstrecke für die
insgesamt vier trainierenden Dölauer waren jedoch die asphaltierten
Wege in der Dölauer Heide. Als Klaus-Jürgen Hofer in die Männerklasse
aufsteigen konnte, bildeten die Sportler eine eigene Staffel. Immerhin
erkämpften die vier Amateure bei den von der GST
(Gesellschaft für Sport und Technik) organisierten
Bezirksmeisterschaften 1967 den Bezirksmeistertitel
(Bezirk Halle). Zwar gab es Bestrebungen seitens des
ASK (Armeesportklub) Oberhof die Amateure für eine intensive Ausbildung im Biathlon in Oberhof zu gewinnen,
aber die Sportler entschieden sich dagegen. Noch vor seinem 30.Geburtstag wendete sich Klaus-Jürgen Hofer
wieder seiner einstigen Leidenschaft zu. Seine Tierbeobachtungen gingen nun über die Dölauer Heide hinaus.
Die Liebe zur Natur führte ihn in interessante Landschaften der DDR. Mit dem Abkommen über den visafreien
Reiseverkehr zwischen der DDR und Polen ergaben sich für den Amateurfotografen ab Januar 1972 neue
Möglichkeiten. Schon als Kind hatte er den
leidenschaftlichen Erzählungen von Vater und Onkel
über die Schönheit seiner ursprünglichen Heimat
aufmerksam zugehört und eine gewisse Neugier
entwickelt. Nun konnte er sich selbst unbürokratisch
von der Schönheit der Masuren und deren Tierwelt
überzeugen. Vorerst waren Reisen in diese Gebiete
zeitlich begrenzt. Neben seinem Beruf blieben für
solche Interessen nur die Wochenenden und die
Urlaubszeit. Eines seiner ersten Projekte, die er umsetzte, war ein Film
über die Großtrappen und Biber. Hier arbeitete er mit dem anfangs
zitierten Peter Ibe zusammen. In Peter Ibe fand er einen Gleichgesinnten,
der ihn und seine damalige Lebenspartnerin in die Masuren begleitete.
Dieser sagte in einem Interview: „Ihm (Hofer) habe ich das Faible für die
6x6-Fotografie zu verdanken.“
1)
Ein weiterer wichtiger Reisebegleiter
war seine Dresdner Spiegelreflexkamera „Pentacon six“. Diese ergänzte
er später durch zwei 16 mm-Filmkameras AK 16 aus Jena und ein
polnisches Tonbandgerät. Seine im Film festgehaltenen Tieraufnahmen
weckten in diesen Jahren die Aufmerksamkeit des Fernsehens. Mit der
Erweiterung des Fernsehprogramms und dem steigendem Interesse der
Zuschauer für Tiersendungen fand er hier einen Abnehmer seiner Filme
und Dokumentationen. Es ist zu vermuten, dass dieses Interesse Klaus-
Jürgen Hofer inspirierte, seine Tierbeobachtungen auszudehnen. Glück hatte er offenbar bei seinem Arbeitgeber, der ihm die
Möglichkeit gab, seinen Urlaub so zu gestalten, dass längere Expeditionen möglich wurden. Um die notwendige Aufnahmetechnik,
Ausrüstung und Lebensmittel zu transportieren kaufte er sich einen Lada und einen speziellen Anhänger. Diese Sonderanfertigung
baute ihn der Dölauer Handwerksmeisters Karl-Heinz Zeidler. Die Möglichkeit seine Filme und Berichte dem Fernsehen zu
verkaufen, führten schließlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der Entscheidung sein Hobby zum Beruf zu machen. Inzwischen hatte
er einen innerbetrieblichen Lehrgang an der Betriebsakademie des Fernsehens absolviert, um seine Kenntnisse zur Kamera- und
Aufnahmetechnologie zu erweitern. Positive Resonanz fanden seine Arbeiten über Gegenden an der Ostsee beim Brockhaus Verlag
in Leipzig. Dieser wurde Hauptpartner von Hofer. Im Buchhandel erschienen mehrere Auflagen
dieser Bildbände. Begleiter seiner Reisen waren neben seiner Lebensgefährtin auch Freunde
und Bekannte, wie z.B. Uwe Steinweg und Wolfram Taubert. Bei umfangreicheren Planungen
engagierte er sogar Mitarbeiter des Fernsehstudios Halle. Seine Arbeiten wurden in diesen
Jahren nicht nur im Fernsehen, sondern auch in wissenschaftlichen Fachkreisen bekannt. So
begleitete er als Kameramann unter anderem Exkursionen von Wissenschaftlern der Martin-
Luther-Universität Halle in die Mongolei. Diese und andere Reiseberichte liefen dann im Ersten
Programm des DDR-Fernsehens und im Bayrischen Fernsehen. Bei einem Klassentreffen im
Jahr 1986 im Dölauer „Café Hartmann“, dem heutigen Waldhotel, berichtete er seinen
ehemaligen Mitschülern noch von seinen weiteren Projekten. Eine Planung, die er nicht mehr
umsetzten konnte. Bei den üblichen Vorbereitungen und einer damit verbundenen Fahrt nach
Berlin wurde er im Januar 1987 Opfer eines Verkehrsunfalles. Dieser ereignete sich auf der
Autobahn in der Nähe von Dessau. Der zu dieser Zeit mit Frau Andrea und Söhnen Thilo und
Falk in Lieskau wohnende Klaus-Jürgen Hofer verstarb im Alter von 45 Jahren noch am
Unfallort.
Werke:
Haustiere, VEB Postreiter Verlag Halle 1978
Im Donaudelta, Verlag: VEB F.A. Brockhaus Verlag, Leipzig, c. 1979.
Ein Jahr in Masuren, 1.Auflage VEB F.A. Brockhaus Verlag Leipzig, DDR, 1981
Zauberfalter, Bilderbuch Mitautor Winfried Völlger, VEB Postreiter Verlag Halle 1981
Haustierkinder, VEB Postreiter Verlag Halle 1982
Rügen – Bilder einer Insel, Verlag VEB F.A. Brockhaus Verlag Leipzig DDR , 1985
Fischland, Darss, Zingst, VEB F.A. Brockhaus Verlag Leipzig DDR , 1986
Reiseberichte:
Mongolische Landschaften, 1986, sechsteiliger Reisebericht Erstausstrahlung 02.08.1986 im TV-DDR
Das Donaudelta, Tierfilm für den Deutschen Fernsehfunk der DDR
Auf Biberfang am Bulgan-Gol - Impressionen einer Expedition im Land der Jurten
Serienproduktionen für das Fernsehen:
Königsfischer Eisvogel, 1978
Auf den Spuren des Elbe-Bibers, 1979
Faszination Donaudelta Teil 1, 1979
Faszination Donaudelta Teil 2, 1979
Faszination Donaudelta Teil 3, 1980
Naturschutzgebiete unserer Heimat – Teil 1 Niederungen zwischen Brandenburg und mittlerer Elbe 1981
Naturschutzgebiete unserer Heimat – Teil 3 In den Wäldern der Mecklenburger Seenplatte, 1981
Heimat zwischen Meer und Gebirge - In der Aue der Mittleren Elbe, 1981
Im schönsten Tal des Pamir Teile 1-3, 1981-1985
Einzelbeiträge in Sendungen wie Tierparkteletreff, Der gefilmte Brehm, Rendezvous mit Tieren oder Waidmannsheil
Sonstige Veröffentlichungen:
Seine Bilder findet man in verschiedenen Fachzeitschriften oder Veröffentlichungen.
Beispiele sind die Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt,
Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt. Landschaftsraum Elbe,
Bilderpräsentationen der „Preußen-Mediathek“ (https://youtu.be/dq74gLiEo8s) u.a. mehr.
Quellen:
1)
Mitteldeutsche Zeitung, 04.03.2019
2)
www.artechock.de/dokfestival/2001/programm/ddr.htm
Bildnachweis:
Foto 1, 5, 6
Archiv Uwe Steinweg
Foto 2, 3
Archiv ElviraTroll
Foto 4
Archiv Werner Thum
Ein besonderer Dank für die umfangreichen Informationen zum Leben von Klaus-Jürgen Hofer gilt Renate Pforte, Elvira Troll,
Gunther Beck, Uwe Steinweg, Werner Thum und Wolfram Taubert.
Bernd Wolfermann, Januar 2020
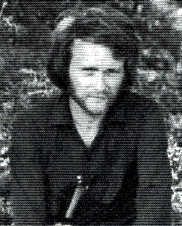
Foto 1

Foto 2: 1.Klasse, Jahrgang 1948 der Dölauer Schule
Klaus-Jürgen Hofer links, stehend

Foto 3: 8.Klasse im Jahr1956 vor der Dölauer Schule
Klaus-Jürgen Hofer, hintere Reihe, 3.von links

Foto 4
Siegermedaille
von
Klaus-Jürgen
Hofer
Bezirksmeister-
schaft
in der Staffel 1967
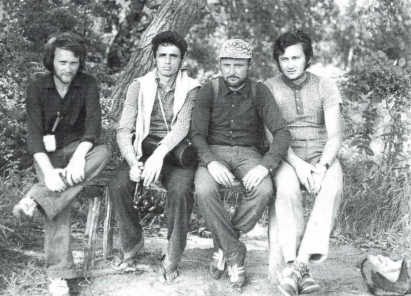
Foto 5: Klaus-Jürgen Hofer (l.) mit Begleiter Uwe
Steinweg (3.v.l) und rumänischen Freunden
1974 im Donaudelta
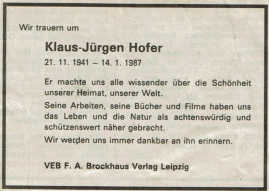
Foto 6
Karl-Heinz Hartmann
11.01.1935 – 17.10.2006
Kommt
man
mit
Einwohnern
eines
Ortes
über
Geschichte
und
Menschen
ins
Gespräch,
so
wird
oft
über
ein
sogenanntes
„Urgestein“
geredet.
Um
es
vorweg
zu
nehmen,
ein
Solches
war
Karl-Heinz
Hartmann.
In
seinen
71
Lebensjahren
engagierte
er
sich
viele
Jahre
ehrenamtlich
und
selbstlos
für
das kulturelle Leben in Dölau.
1935
wurde
er
in
dem
1927
von
seinen
Eltern
gebautem
Haus
im
Heideweg
geboren.
Er
wuchs
in
Dölau
auf
und
besuchte
hier
die
Schule.
„Kalle
war
ein
guter
Kamerad,
frei
von
Hinterhältigkeit
und
Intrige,
pfiffig,
ideenreich
und
fast
immer
gut
gelaunt“,
charakterisierte
ihn
sein
Freund
und
Mitschüler
Klaus
Uhrbach.
Wie
in
dieser
Zeit
üblich,
hieß
es
dann
mit
Abschluss
der
8.Klasse
eine
passende
Lehrstelle
zu
finden.
Mit
14
Jahren
begann
er
eine
Lehre
im
RAW
(Reichsbahn-
Ausbesserungs-Werk)
Halle.
Als
Lokschlosser
arbeitete
er
nicht
lange.
Eine
Werbeaktion
der
Bahn
für
Heizer
von
Dampflokomotiven
war
für
den
jungen
Karl-Heinz
Hartmann
die
Gelegenheit
in
den
Führerstand
einer
dieser
großen
Dampf-
maschinen
zu
gelangen.
Er
sagte
zu
und
begann
als
Lokhelfer
auf
einer
dieser
Lokomotiven.
Es
sollte
für
ihn
eine
Tätigkeit
auf
Lebenszeit
werden.
Seine
Liebe
zur
Bahn
forderte
ihn
heraus.
Er
wollte
nicht
nur
als
Heizer
im
Führerstand
tätig
sein,
sondern
eine
Lok
selbst
führen.
Nach
Probezeit
und
Qualifikation
konnte
er
seinen
Traum
als
Lokführer
verwirklichen.
In
den
folgenden
Jahren
beherrschte
er
die
Technik
der
Diesel-,
als
auch
der
Elektroloks.
Als
er
sich
zum
Gruppenlokführer
qualifizierte,
hatte
er
regelmäßige
Arbeitstage
und
somit
mehr
Zeit
für
seine
zweite
Leidenschaft,
die
Musik.
Er
spielte
zwar
Akkordeon,
fühlte
sich
jedoch
zu
der
aufkommenden
Unterhaltungsart
des
Schallplattenunterhalters,
abgekürzt
SPU,
hingezogen
(im
englischen:
disc
jockey,
Kurzform:
DJ;
in
der
DDR
hieß
es
„staatlich
geprüften
Schallplattenunterhalter“).
Karl-Heinz
Hartmann
absolvierte
einen
Eignungstest
und
einen
Grundlehrgang
mit
anschließender
staatlicher
Prüfung
bei
dem
dafür
zuständigen
Kreis-
bzw.
Stadtkabinett
für
Kulturarbeit.
Als
„staatlich
geprüfter
Schallplattenunterhalter“
durfte
er
nun
öffentlich
Tonträger
abspielen,
musste
jedoch
regelmäßig
an
Weiterbildungsveranstaltungen
teilnehmen,
um
seine
Lizenz
zu
behalten.
Die
höchste
Einstufung
legte
er
1980
ab.
Zum
Einsatz
kam
er
hauptsächlich
am
Wochenende.
Im
„Café
am
Heiderand“,
im
Dölauer
Sprachgebrauch
„Café
Hartmann“
(der
Besitzer
Wilhelm
Hartmann
war
nur
ein
Namensvetter),
sorgte
Karl-Heinz
Hartmann
für
die
musikalische
Umrahmung
der
Tanzveranstaltungen.
Nachdem
sein
Cousin
Horst
Hartmann
1977
das
von
der
HO
erworbene
Restaurant
als
Leiter
führte,
setzte
er
die
musikalische
Unterhaltung
fort.
1978
trat
er
dem
Verkehrssicherheitsaktiv
bei
und
übernahm
den
Bereich
Kultur.
Mit
seinen
Veranstaltungen
sorgte
damals
das
Verkehrssicherheitsaktiv
für
kulturelle
Höhepunkte
in
Dölau
(von
Tanzveranstaltungen
bis
Rentnerfahrten).
Die
Organisation
lag
mit
in
den
Händen
von
Kalle,
wie
er
von
seinen
Freunden
und
Mitstreitern
kurz
genannt
wurde.
Um
das
Kulturleben
reicher
zu
gestalten,
regte
er
beim
Wohnbezirksausschuss
der
„Nationalen
Front“
1)
in
Dölau
die
Gründung
eines
„Klubs
der
Werktätigen“
an.
Als
Leiter
diesen
Klubs
bereitete
er
die
Wiederbelebung
der
früheren
Heidefeste
im
„Heidekrug“
vor.
Schon
1982
fand
in
Dölau
das
1.Heidefest
statt.
Die
Heidefeste
wurden
in
den
Folgejahren
über
die
Ortsgrenze
Dölaus
bekannt
und
erfreuten
sich
großer
Beliebtheit.
2)
Im
Umfeld
von
Dölau
gab
es
bereits
seit
Jahrzenten
einige
Karnevalvereine.
Dieses
Metier
begeisterte
Kalle
so
sehr,
dass
er
auch
in
Dölau
die
Gründung
eines
Karnevalvereins
anregte.
Dazu
konnte
er
die
Mitglieder
des
Verkehrssicherheitsaktivs
überzeugen.
„Die
Mitglieder
des
Verkehrssicherheitsaktivs
bildeten
dann
auch
den
Kern
des
ersten
Elferrates
unter
Leitung
seines
Präsidenten
Karl-Heinz
Hartmann.“
3)
Der
„Carnevals
Club
Blau-Silber
Dölau
e.V.“
war
wohl
sein
Lieblingskind.
Hier
engagierte
er
sich aufopferungsvoll bis zu seinem Tod.
Erwähnenswert
ist
auch
die
Periode
um
1990.
Mit
dem
Beitritt
der
DDR
zur
BRD
wurden
die
gesellschaftlichen
Strukturen
vollständig
verändert.
Der
„Klub
der
Werktätigen“
musste
aufgelöst
werden.
Um
einen
zukünftigen
Träger
für
die
kulturelle
Arbeit
in
Dölau
zu
haben,
gründete
Karl-Heinz
Hartmann
am
10.08.1990
den
„Heimatverein
Dölau“, dessen Vorsitz er ebenfalls übernahm.
Mit
seinem
Tod
im
Jahre
2006
verlor
Dölau
einen
Menschen,
der
nicht
das
Private
in
den
Vordergrund
stellte,
sondern
immer
für andere zur Verfügung stand und versuchte seinen Mitmenschen frohe und unterhaltsame Stunden zu verschaffen.
(B.W., Jan. 2018)
1)
Die „Nationale Front“ war ein Zusammenschluss aller Parteien und Massenorganisationen in der DDR mit örtlichen
Strukturen
2)
Weitere Informationen über den „Klub der Werktätigen“ finden man in Nr.10 der „Dölauer Hefte“ (Dölauer Vereine)
3)
Zitat aus „Dölauer Vereine“, S.195 (Dölauer Heft Nr. 10)




Foto der Klasse von Karl-Heinz Hartmann im
Frühjahr 1949
***
Karl-Heinz Hartmann
mit seiner
„Disko am Heiderand“
Karl-Heinz Hartmann mit Klaus
Zimmermann in den 80er Jahren
***
Dr. Jörg-Thomas Wissenbach
geboren am 11. Januar 1955
Wenn
Dölauerinnen
oder
Dölauer
in
einem
Plausch
zufällig
auf
die
Geschichte
ihres
Ortes zu sprechen kommen, fällt unweigerlich an einer Stelle auch der Name
Dr.
Wissenbach.
Seinen
Namen
verbinden
die
EinwohnerInnen
unseres
Stadtteils
in
erster
Linie
mit
den
„Dölauer
Heften“
und
den
im
Waldhotel
oder
im
Gemeindehaus
stattgefundenen Vorträgen über die Historie Dölaus.
Dr.
Wissenbach,
geboren
am
11.
Januar
1955
in
Halle,
wuchs
im
Paulusviertel
auf,
hat
in
Halle
sein
Abitur
gemacht,
studiert
und
anschließend
im
internationalen
Wirtschaftsrecht
promoviert.
Für
dieses
Fachgebiet
war
er
von
1984
bis
1987
als
Dozent
in
Angola
und
hat
anschließend
eine
Habilitationsschrift
zur
internationalen
Atomhaftung
vorgelegt.
Durch
die
Abwicklung
der
Sektion
Staats-
und
Rechtswissenschaften
der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
musste
sich
Dr.
Wissenbach
neue
Betätigungsfelder
suchen.
Seit
1992
ist
er
als
Rechtsanwalt
in
eigener
Kanzlei
tätig
und
hat
bei
den
verschiedensten
Bildungseinrichtungen
als
Dozent
gewirkt.
Im
Dezember
1993
eröffnete
er
in
einem
von
ihm
sanierten
Haus
in
Dölau
seine
Anwaltskanzlei
und
engagierte
sich
als
Herausgeber
der
Festzeitung
zum
100.
Gründungsjubiläum
der
Freiwilligen
Feuerwehr
Dölau
im
Jahr
2005
und
als
Organisator
der
Festzeitung
zum
30.
Jubiläum
des
Dölauer
Carnevalsvereins
„Blau-Silber“
im
Jahr
2010.
Sein
Interesse
an
der
Dölauer
Heimatgeschichte
wurde
durch
sein
Bemühen
geweckt,
im
Jahr
2010
eine
Chronik
der
verschiedenen
gewerblichen
Nutzungen
seines
Hauses
in
der
Franz-Mehring-Straße
vorzulegen.
Bei
der
Suche
nach
Bildern
aus
der
Entstehungszeit
1910
bei
Nachbarn
erfuhr
er
viele
Details
zur
überaus
wechselvollen
Geschichte
der
früheren
Kirchstraße
und
hat
die
Geschichte
seines
Hauses
auf
diese
das
Hut-
und
Kopftuchviertel
in
Dölau
verbindende
Straße
erweitert.
Die
Vorstellung
dieser
A4-Broschüre
im
Waldhotel
und
in
der
Kirchgemeinde
stieß
auf
derart
großes
Interesse,
dass
die
Idee
geboren
wurde, auch weitere Themenbereiche in Dölau in Heftform vorzustellen.
Auf
seine
Initiative
kam
es
am
09.12.2011
zum
ersten
Treffen
von
Hobbyhistorikern
aus
Dölau
und
dem
Umfeld
(ehemalige
Dölauer).
Hier
präsentierte
er
die
Idee
über
die
Schaffung
einer
Publikationsreihe.
Dieser
konzipierten
Reihe
legte
er
schließlich
12
Themen
zu
Grunde.
Für
jedes
Heft gelang es ihm Fachleute und Autoren zu gewinnen.
Jeweils
im
Frühjahr
und
im
Herbst
der
Jahre
2012
bis
2017
wurde
dann
ein
neues
Dölauer
Heft
veröffentlicht
und
in
jeweils
dem
Thema
angemessener
Form
in
Lichtbildervorträgen
vorgestellt.
Die
dabei
erforderlichen
Requisiten
sowie
die
Schaufenstergestaltung
im
Waldhotel
hat
er
zeitaufwändig
selber
gebaut.
Speziell
die
alteingesessenen
Dölauer
wissen
es
zu
würdigen,
dass
mit
dieser
Heftreihe
die
gerade
noch
erreichbaren
Erinnerungen,
aber
auch
Dokumente
zur
Dölauer
Heimatgeschichte
gesammelt
und
veröffentlicht
werden
konnten.
Als
Ehrenmitglied
der
Freiwilligen
Feuerwehr
sorgt
Dr.
Wissenbach
bei
jeder
Versammlung
für
einen
kulturellen
Beitrag.
Bei
sogenannten
Nachtwächterrundgängen
hat
er
Interessenten
die
Schul-
oder
Landwirtschaftsgeschichte
von
Dölau
vorgestellt
oder
zusammen
mit
dem
Landesheimatbund
Führungen
durch
die
Dölauer
Kirchen
oder
die
Dölauer
Heide
mitgestaltet.
Auch
in
den nächsten Jahren will er sich für den Ortsteil engagieren.
Halle, im Februar 2018




***
Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Dresig
31.Januar 1937 - 25.April 2018
Wenn wir in unserer Serie „Dölauer*innen“ Personen vorstellen, die in unserem Ort geboren
wurden oder hier gelebt haben, so gehört auch Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Dresig dazu.
Er war einer der bekanntesten Maschinenbauingenieure und Fachmann auf dem Gebiet der
Maschinendynamik. Am 31.01.1937 erblickte er in Dölau das Licht der Welt.
Seine Eltern waren Marie Emmi Dresig, geb. am 17. 9. 1903 in Dölau und Max Erich Dresig,
geb. am 4. 5. 1903 in Bronkow, Stellmachermeister aus Halle.
Marie Emmi, geborene Arndt, arbeitete als Blumenbinderin bis zu ihrer Heirat (27. 2. 1936
in Dölau) in der familiären Gärtnerei der Lettiner Straße 38 (heute Elbestraße), die von ihrem
Bruder Walter Arndt geführt wurde. Dieses Familienunternehmen wurde um ca. 1900 von
Friedrich Arndt gegründet.
Nach der Hochzeit von Emmi Arndt und Erich Dresig wohnte Erich einige Zeit mit in der Gärtnerei und arbeitete aber als
Stellmachermeister beim Karosserie- und Fahrzeugbau Franz Dresig, einem Verwandten der Familie. Nach der Geburt ihres
Sohnes Hans zogen sie bald nach Halle in die Krondorfer Straße 6.
Hans Dresig wuchs in den folgenden Jahren in Halle auf und kam mit
seinen Eltern nur noch zu Familientreffen nach Dölau.
Nach dem Schulabschluss bot sich für ihn die Möglichkeit an der
Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Halle die Hochschulreife zu erlangen.
Anschließend studierte Hans Dresig von 1954 bis 1960 an der
Technischen Universität Dresden. Danach arbeitete er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mechanik der
Technischen Universität Dresden und promovierte dort 1965 mit dem Thema „Ermittlung dynamischer
Belastungen an Wippdrehkranen“. Von 1965 bis 1969 war er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter
und danach als Leiter für Forschung und Entwicklung im Kranbau Eberswalde tätig.
1970 wurde Hans Dresig als Hochschuldozent für Maschinendynamik an die Technische Hochschule
Karl-Marx-Stadt berufen. Seine Dissertation B mit dem Thema „Beitrag zur Optimierung der
Bewegungsabläufe in der Maschinendynamik“ verteidigte er 1971 an der Technischen Universität
Dresden. Während seines sechsmonatigen Zusatzstudiums 1975/1976 am Moskauer Textilinstitut knüpfte
er zahlreiche Kontakte zu russischen Fachkollegen, aus denen sich in den Folgejahren eine enge,
wissenschaftliche Zusammenarbeit entwickelte. Als Nachfolger von Professor Dr. H. Göcke wurde Hans
Dresig 1978 zum Professor für Technische Mechanik an die Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt und
nach der politischen Wende 1992 zum Professor für Maschinendynamik/Schwingungslehre an die Technische Universität
Chemnitz berufen.
4)
Nach dem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2002 war er freiberuflich als Referent, Berater und Gutachter tätig. Von 2009 bis
2013 lehrte er als Gastprofessor an der Fakultät Maschinenbau der Landwirtschaftlichen Universität Nanjing in China.
Für sein Engagement bei der Erarbeitung von VDI-Richtlinien wurde Hans Dresig 1999 mit der Fritz-Kesselring-Ehrenmedaille
des VDI ausgezeichnet.
2)
Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Dresig verstarb am 25. April 2018 in Auerswalde. Er hinterließ seine Ehefrau Barbara Dresig, die
Tochter Almuth und Söhne Frank und Friedmar.
Veröffentlichungen:
H. Dresig, I. I. Vulfson: Dynamik der Mechanismen, Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin 1989
H. Dresig, F. Holzweißig: Maschinendynamik, Springer-Verlag (Standardwerk
Maschinendynamik)
H. Dresig, A. Fidlin: Schwingungen mechanischer Antriebssysteme: Modellbildung,
Berechnung, Analyse, Synthese. 3. Auflage. Springer Vieweg, 2014
H. Dresig, M. Beitelschmidt: Maschinendynamik – Aufgaben und Beispiele. 2. Auflage.
Springer Vieweg, 2017
Quellen:
1) Adressbuch Halle (Saale) 1941, Seite I-061
2) https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Dresig
3) Fotos: Barbara Dresig
4) Nachruf des Instituts für Mechanik und Thermodynamik der Technischen Universität Chemnitz, http://www.hans.dresig.de/








Auszug vom Adressbuch
Halle (Saale) 1941
1)
Eltern von
Hans Dresig
1937 in Dölau
3)


***
Dr. Helga Einsele geb. Hackmann
09. Juni 1910 – 13. Februar 2005
Wolfgang Abendroth, der erste Marxist auf einem bundesdeutschen Lehrstuhl
und Ziehvater der BRD-Linken, würdigte in seinem autobiographischen
Gesprächsprotokoll "Ein Leben in der Arbeiterbewegung" (Frankfurt/M. 1976)
Einsele als "die hervorragende Spezialistin für einen humanen Strafvollzug".
Sie stand für Emanzipation, Humanisierung des Strafvollzugs und linke Politik
jenseits der Parteiraison. Ihre Lebensgeschichte ist zugleich ein Zeitdokument, in
dem die Geschichte des demokratischen Sozialismus in Deutschland, als Teil
einer Jahrhundertbilanz, mit eingegangen ist.
1)
In Dölau am 9. Juni 1910 geboren, wohnte Helga Einsele in den ersten
Kinderjahren mit ihren Eltern Frieda und Dr. Friedrich Hackmann in der
Kirchstraße 9 (heute Franz-Mehring-Straße). Registriert ist ihre Taufe in den
Unterlagen der evangelischen Gemeinde Dölau am 01. September 1910.
2)
Ihr Vater, der vom 01.10.1908 an den Franckeschen Stiftungen in Halle/Saale
unterrichtete, wurde durch den Kriegsdienst 1914 aus seiner Lehrtätigkeit herausgerissen.
Als er am 01.10.1918 die Stelle als Direktor des Makensengymnasiums in Torgau übernehmen konnte, verlegte die vierköpfige
Familie ihren Wohnsitz hierher. Bereits fünf Jahre später am bot man dem Familienvater die Stelle eines Oberstudiendirektor am
Johanneum Lüneburg an. Dort besuchte sie wie ihre Schwester Erdmuthe (ebenfalls am 19.02.1913 in Dölau geboren) das
Johanneum, eines der ältesten Gymnasien in Deutschland. Beide Mädchen sollten später in Hessen Karriere machten: Als Erdmuthe
Falkenberg wurde die eine Leiterin des Landesjugendamtes Hessen, als Helga Einsele die andere Leiterin der hessischen
Strafvollzugsanstalt für Frauen. Beide wurden bundesweit bekannt als Reformerinnen - des Jugendwohlfahrtsrechts bzw. des
Strafvollzugsrechts.
Helga und Erdmute wuchsen in einem bürgerlich-demokratisch gesinnten Elternhaus auf. Ihre Mutter war schon sehr früh in der
Frauen-Emanzipationsbewegung tätig. Der Vater war 1914 als konservativ-patriotischer Bürger in den Krieg gezogen und kehrte aus
ihm als liberaler Republikaner zurück. Dahin hatte ihn nicht nur das im Krieg erlebte mörderische Grauen gebracht, sondern ebenso
sehr der hierarchisch-bürokratische Stumpfsinn des Militärapparats. Friedrich Hackmann ließ an seinem Gymnasium stets die
schwarz-rot-goldene Fahne hissen, gegen den Widerstand der Mehrheit seines Kollegiums, die auf Schwarz-Weiß-Rot standen.
Hackmann wurde konsequenterweise als einer der ersten höheren Beamten 1933 von den Nazis in Lüneburg "aus dem Schuldienst
entfernt". Zu seinen Schülern gehörte übrigens ein späterer Oberbürgermeister Frankfurt am Mains: Werner Bockelmann. Der
Rausschmiss Friedrich Hackmanns wurde zusätzlich mit dem "linksradikalen Engagement" seiner in Heidelberg studierenden Tochter
Helga begründet.
1)
Helga Einsele sagt von sich, sie habe sich 1930, nach "Überwindung bürgerlicher Skrupel", den sozialistischen Studentengruppen
genähert und sei dann in die SPD eingetreten. Sie wurde Mitorganisatorin antifaschistischer Kundgebungen. Bei der Wahl zum
Allgemeinen Studenten-Ausschuss kandidierte sie gegen den späteren NS-Reichsstudentenführer Gustav-Adolf Scheel.
1931 ging Helga Hackmann in die USA, interessiert allgemein am dortigen Strafvollzug und speziell an der Stellung von Frauen. Sie
war mit ihrem späteren Mann, dem Biologen Wilhelm Einsele, nach New York gegangen. Der hatte ein Stipendium an der Columbia
University erhalten; in New York heirateten die beiden. Helga schrieb in New York an ihrer Doktorarbeit, die von dem Nachfolger
Radbruchs in Heidelberg Engelhard übernommen worden war. Als beide nach der "Machtergreifung" nach Deutschland
zurückkehrten, mussten sie sich mehr schlecht als recht durchschlagen, bis Wilhelm Einsele eine adäquate wissenschaftliche
Tätigkeit aufnehmen konnte. Ihre Tochter Nele wurde 1941 in Berlin geboren, wo Eltern und Schwester lebten.
Zurückgekehrt nach Deutschland, ernannte 1947 der legendäre Ministerpräsidenten des roten Hessens, Georg August Zinn, Helga
Einsele zur Leiterin des Frauengefängnisses in Frankfurt-Preungesheim, wo sie 28 Jahre "Einblick hatte in schlimmes Lebenselend",
wie sie in ihren vor zehn Jahren erschienenen Memoiren "Mein Leben mit Frauen in Haft" (Stuttgart 1995) schrieb.
Sie setzte es durch, dass die Zellen in einen menschenwürdigen Zustand gesetzt, vor allem erst einmal mit modernen hygienischen
Einrichtungen ausgestattet wurden. Sie führte Therapie- und Selbsthilfegruppen im Gefängnis ein, lange bevor diese Ansätze breite
Anerkennung fanden. Zu ihren Reformen gehörte, dass Beamte die Gefangenen nicht duzen und dass die Frauen normale Kleidung
tragen durften; jede bekam außerdem eine für sie zuständige Sozialarbeiterin. Durch eine niedrigere Rückfälligenquote erregte
Einseles Ansatz überregional Aufmerksamkeit. Vorbildlich wirkte vor allem das von ihr institutionalisierte Mutter-Kind-Haus, mit dem
sie vermied, dass Kleinkinder und eingesperrte Mütter auseinandergerissen wurden.
Dabei musste sie zugleich heftigen, politisch-ideologisch fixierten Widerständen gegen diese Humanisierung des Strafvollzugs
begegnen. Doch es wurde ihr auch Hilfe bei ihrer Arbeit zuteil. Vor allem der damalige Hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer,
der unermüdlich bis zu seinem Tod für eine demokratische Justiz und die Verfolgung von Naziverbrechen kämpfte, stand ihr zur Seite.
(Als juristische Kampfgefährtin des Initiators des berühmten Frankfurter Auschwitzprozesses, überlieferte sie Bauers Ausspruch:
"Wenn ich mein Büro verlasse, fühle ich mich wie im feindlichen Ausland.") Unterstützung kam außerdem von einer kleinen Gruppe
von Strafverteidigern, die eine radikal republikanische, sozialdemokratische oder sozialistische Vergangenheit hatten.
Jenseits ihres Fachgebiets und Berufs war Einsele engagiert in den politischen Auseinandersetzungen der Republik. In Frankfurt trat
sie erst 1953 wieder in die SPD ein, dann aber keineswegs beschränkt auf eine formale Mitgliedschaft. In Frankfurt begann, mit der
Rückkehr deutscher Hochschullehrer, vor allem aus der amerikanischen Emigration, für die intellektuellen Linken und den inzwischen
gegründeten Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) eine kritische Auseinandersetzung mit der nach dem Krieg schnell sich
erholenden, westdeutschen, kapitalistischen Gesellschaft.
Als im November 1959 in der Stadthalle von Bad Godesberg die SPD die Weichen für ihren weiteren Weg stellte, gab es 16 Stimmen
gegen das dann so genannte "Godesberger Programm", in dem erstmals von Sozialisierung und Arbeiterklasse nicht einmal mehr die
Rede war - eine der Gegenstimmen kam von der Frankfurter Delegierten Einsele.
Anfang der sechziger Jahre wurde der SDS, aus dem die 68-iger Bewegung hervorging, als zu linkslastig aus der SPD verdrängt.
Einsele gehörte zusammen mit anderen undogmatischen Linken wie den Hochschullehrern Abendroth, Ossip K. Flechtheim oder
Heydorn zu den Gründern der Sozialistischen Fördergemeinschaften für den SDS, auf welche die SPD mit Unvereinbarkeitsbeschluß
und Parteiausschluss reagierte:
Einsele wirkte über ihren Beruf hinaus nach 1962 politisch weiter. So half sie französischen Deserteuren, die vor dem Einsatz in
Algerien geflohen waren, unterstützte Ostermärsche und bemühte sich um die Demokratisierung des Rechtsystems.
Auch 1975, nach ihrer Pensionierung, verließ Einsele keineswegs die politische Bühne. Neben ihrer mehrjährigen Tätigkeit als
Honorarprofessorin für Kriminologie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main und Fachautorin, galt ihr weiterhin ungebrochenes Interesse einer weltweiten Friedenspolitik. Als "demokratische Sozialistin", so
ihr Anspruch, beteiligte sie sich an den Auseinandersetzungen über die neuen Mittelstreckenraketen (SS-20 im Osten, Pershing-2 im
Westen) Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre. In Mutlangen bei der Pershing-Depotblockade (zusammen u.a. mit Heinrich
Böll, Helmut Gollwitzer und Walter Jens) wurde die Siebzigjährige von der Polizei abgeführt.
1969 wurde sie erste Fritz-Bauer-Preisträgerin. Andere Ehrungen kamen hinzu: darunter 1976 den Humanitären Preis der deutschen
Freimaurer
4)
,das Land Hessen ehrte sie mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille, sie war Tony-Sender-Preisträgerin der Stadt Frankfurt
1992 (Tony Sender war bis 1933 Frankfurter Reichstags-Abgeordnete der SPD und eine weit über Deutschlands Grenzen hinaus
bekannte Frauen- und Sozialrechtlerin) und noch im März 2002 wurde sie an der Fachhochschule Potsdam als Vorkämpferin für einen
humanisierten Strafvollzug in Deutschland geehrt.
Zu ihrem 80. Geburtstag hatte Helga Einsele sich für viele Lobreden, die mitunter wie Nachrufe zu Lebzeiten klangen, freundlich
bedankt und dabei angemerkt: "Und nun will ich Ihnen noch etwas sehr persönliches verraten". Pause. "Ich möchte", sagte sie, "noch
eine ganze Weile da sein. Denn ich bin neugierig, wie es weitergeht." Verschont von schweren Krankheiten, bis zuletzt geistig rege
und nicht nur mit Leserbriefen noch die Öffentlichkeit suchend, starb Helga Einsele am 13.02.2005 94-jährig in einem Krankenhaus in
Frankfurt am Main.
1)
Veröffentlichungen:
-
Frauen im Strafvollzug. Rowohlt, Reinbek 1985, ISBN 3-499-14855-2 (zusammen mit Gisela Rothe)
-
Frauen im Strafvollzug . Auf der Suche nach etwas, das besser ist als Strafe.
Helga EINSELE & Gisela ROTHE Rowohlt Taschenbuch, 1982, Taschenbuch ISBN: 3499148552
-
Das Verbrechen, Verbrecher einzusperren. Helga Einsele antwortet Ernst Klee (Das theologische Interview; 20). Patmos-Verlag,
Düsseldorf 1970.
-
Das Verbrechen Verbrecher einzusperren: Strafvollzug der positiven Zuwendung Das theologische Interview ; 20
Einsele, Helga und Ernst Klee Düsseldorf : Patmos-Verlag, 1970.
-
Mein Leben mit Frauen in der Haft - Stuttgart : Quell-Verlag, 1994, 1. Aufl.
-
Die Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe, Einsele, Helga ; Feige, Johannes ; müller-dietz, heinz Ferdinand Enke Verlag ,
1972, PaperbackISBN: 3432017499
-
Frauen im Gefängnis
Dürkop, Marlis / Hardtmann, Gertrud (Hrsg.) - Mit Beiträgen von Gertraud Will, Susanne Aschermann, Harriet Kümpel,
Petra Schlagenhauf, Helga Einsele, Hanna Dupuis; Renate Traxler u.a.
Suhrkamp (Edition Suhrkamp Bd. 916), 1978, Taschenbuch ISBN: 3518109162
Quellen:
1)
Die Biografie stützt sich auf den Artikel von Günter Platzdasch und Heiner Halberstadt,
Aufrechter Gang und Eigen-Sinn: Helga Einsele, Nachruf des Linksnet von 8. März 2005
2)
Taufregister der evangelischen Gemeinde Dölau
3) http://www.humanistische-union.de/nc/aktuelles/aktuelles_detail/back/
Heinz Brakemeier - Die Arbeit Helga Einseles für die Humanisierung des Strafvollzugs
Versuch einer kritischen Würdigung aus Vorgänge Heft 6/1969, S. 217-219
4) http:// freimaurer-wiki.de/index.php/Auszeichnungen
Dank gilt Herrn Hermann Möller für weitere Informationen.
Bildquelle: Frau Dr. Helga Einsele spricht als Leiterin der Frauenhaftanstalt Frankfurt am Main-Preungesheim im Filmbericht:
Strafvollzug und Reformbestrebungen in deutschen Gefängnissen, Produktion: Reinhart Müller-Freienfels,
Regie: Fritz Umgelter, 1956

Frau Dr. Helga Einsele spricht als Leiterin der
Frauenhaftanstalt Frankfurt am Main-
Preungesheim in dem Filmbericht: Strafvollzug
und Reformbestrebungen in deutschen
Gefängnissen, 1956
***
Hans Kunze
06. August 1928 – 25.Juli 2020
Der Komponist, Arrangeur und Musiker Hans Kunze wohnte in den 1940iger und 1950iger Jahren in
der jetzigen Dölauer Stadtforststraße 52. Geboren wurde er am 06.08.1928 in Naumburg. Dort
absolvierte er seine Schulausbildung und begann auf Drängen des Vaters eine Verwaltungslehre.
Bereits im Kindesalter entwickelte sich in ihm eine Leidenschaft für die Musik. Einmal in der Woche
nahm er Akkordeonunterricht und nach anfänglichem autodidaktischem Klavierspiel konnte er sein
musikalisches Können durch Klavierstundenunterricht vervollkommnen. Mit Sicherheit war dieses
musikalische Interesse auch ein Ergebnis seines Umfeldes. In seinem Buch „Hands up oder es knallt“
schreibt Hans Kunze: „Besonders in der Herbst- und Winterzeit wurde in unserer Familie viel musiziert.
Wir versammelten uns im Wohnzimmer. Die Eltern brachten neue Lieder aus ihrem Gesangsverein
mit nach Hause. Gretel (Schwester) spielte Gitarre und ging auch zum Unterricht.“
Als seine in Dölau lebende Großmutter kränkelte und Hilfe benötigte, zog Familie Kunze noch
während des Zweiten Weltkrieges nach Dölau. Für ihn bestand hier zumal die Möglichkeit seine Lehre
am Landratsamt in Halle fortzusetzen. Doch noch im Januar 1945 erhielt der 16jährige einen
Einberufungsbefehl.
Im Vorwort des bereits erwähnten Buches sind die folgenden Jahre wie folgt beschrieben: „Vier Wochen ist er zur Ausbildung, als man
ihn und seinesgleichen nach Hause schickt. Es ist April 1945, die Fallschirmjägerschule in Gardelegen löst sich auf. Nunmehr beginnt
für den Halbwüchsigen eine mehrjährige Kriegsgefangenschaft, die auf den Rheinwiesen ihren Anfang nimmt, über Belgien schließlich
zu einem Minenräumkommando in Holland führt. Dort gründet der Akkordeonspieler eine Band, die „Hot Five“. Kunze überlebt mit der
Musik, aus der er nach seiner Rückkehr seinen Beruf machen wird.“
Täglich führte ihn sein Weg von Dölau nach Halle. Hier studierte er an der Hochschule für Theater und Musik. Diese Zeit schildert er mit
folgenden Worten in seinem Buch: „Wenn wir (Hier meint er Hilmar Thate, der schräg gegenüber seines Elternhauses wohnte und einer
der bekanntesten Theaterschauspieler wurde.) uns zu Fuß in die Stadt begaben, also nach Halle marschierten, liefen wir ein Stück
durch die Dölauer Heide. … Während sich Hilmar mit den Bühnenklassikern beschäftigte, hatte ich irgendwelche Melodien im Kopf.
Tonfolgen und Rhythmen verschiedener Art waren unablässig in meinem Kopf. Mein Gehirn war mein Instrument, ich konnte ja nicht
mein Akkordeon mitschleppen, es war zu schwer und der Weg zu weit.“
1)
Als Komponist, Arrangeur und Musiker sollte er in seinem Leben mehr als 650 Schlager, Filmmusiken, Musicals (u. a. »Heute Nacht
kommt Conny«) und größere Orchesterwerke komponieren. Diese Kompositionen schrieb er unter anderem für Dagmar Frederic,
Hartmut Eichler, Peter Wieland, Petra Kusch-Lück, die Amigos, Roland Neudert, Siegfried Koenig, Bisser Kirow, den Günter
Oppenheimer-Chor, Bärbel Wachholz, Fred Frohberg, Vera Schneidenbach, das Große Tanzstreichorchester des Deutschlandsenders,
Vaclav Neckar und weitere Sänger.
2)
Unter anderem schrieb er 1959 "Die alte Ballmelodie", die zu einem Erfolg wurde. Bald darauf
tourte er einige Jahre mit eigenen Bands durch das Land und widmete sich der Theaterarbeit. Für den DEFA-Film "Spur der Steine"
steuerte er 1966 drei Kompositionen bei und 1968 wurde sein erstes Musical "Heute Nacht kommt Conny" in Brandenburg/Havel
uraufgeführt. Auch nach 1990 komponierte Hans Kunze Melodien für Film, Fernsehen und für den Schlagergesang.
Wann Hans Kunze seinen Wohnsitz in Dölau aufgab, konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau ermittelt werden.
Die letzten Jahre lebte er im Potsdamer Stadtteil Fahrland. Er verstarb am 25. Juli 2020 und wurde auf dem Neuen Friedhof in
Potsdam beigesetzt.
(BW, Januar 2025)
Anhang
Beispiele der Kompositionen von Hans Kunze (siehe PDF-Datei)
3)
Quellen
1) Hans Kunze, Hands up oder es knallt, Verlag am Park, Berlin 2008
2) Aus dem Autorenverzeichnis der Eulenspiegel Verlagsgruppe
https://www.eulenspiegel.com/autoren/autor/823-hans-kunze.html
3) www.ddr-tanzmusik.de/index.php/Hans_Kunze
4) Fotoabdruck mit freundlicher Genehmigung der edition ost Verlag und Agentur GmbH, Berlin.